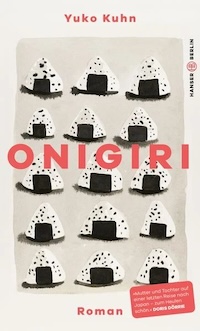
In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur kreisen viele Texte um Fragen nach Herkunft, Identität und dem Ringen um Zugehörigkeit. Besonders eindringlich sind die Stimmen der Kinder und Enkel
der sogenannten „Gastarbeitergeneration“, die von Nähe und Distanz zu ihren Eltern erzählen, oft im Spannungsfeld zwischen Heimat und Fremde, zwischen Türkei, Südeuropa oder Osteuropa und
Deutschland. Yoko Kuhns Roman Onigiri erweitert dieses Panorama um eine leise, bislang selten erzählte Perspektive: die deutsch-japanische Erfahrung.
Yuko Kuhn schöpft dabei aus eigener Familiengeschichte. Die Erzählerin porträtiert ihre Mutter mit einer Mischung aus Zuneigung und Beobachtungsgabe, die jeden Satz nachklingen lässt. Ein
wiederkehrendes Bild verdichtet das Gefühl von Entfremdung: Die Mutter, zusammengesunken auf dem Sofa, die Knie angezogen, das Gesicht in den Händen verborgen, ein stiller Ausdruck von
Verlorenheit und der Schwierigkeit, in der neuen Heimat Fuß zu fassen.
„Oft sagt meine Mutter, sie wolle doch nur die Augen ausruhen, sie würde sie mit den Händen wärmen, ihnen Energie geben, aber für mich sieht es trotzdem aus, als weine sie". (S.
14)
Im Zentrum des Romans steht eine letzte gemeinsame Reise nach Japan, in die Heimatstadt Kobe. Zwischen knarzenden Holzdielen, dem Duft von Misosuppe und vertrauten Geräuschen der Kindheit werden
Erinnerungen lebendig, die der Demenz zu entgleiten drohen. In diesen Momenten öffnet sich das Fenster zu einer Welt, die der Mutter einst Halt und Identität bot und die nun für beide zu einem
Spiegel ihrer eigenen Geschichte wird.
Yuko Kuhn erzählt nicht linear, sondern wie in einem Flickenteppich aus Gegenwart und Erinnerung. Szenen der Reise verweben sich mit Rückblenden in die deutsch-japanische Familiengeschichte: von
der jungen Lehrerin, die in den 1960er-Jahren mutig nach Deutschland aufbricht, bis zur Einsamkeit der Migrantin im deutschen Alltag, zwischen schwierigen Schwiegereltern, subtiler
Fremdenfeindlichkeit und der Suche nach kulturellem Halt. Den kulturellen Halt findet sie in ihrem Chor.
„Meine Mutter kennt eine unglaubliche Anzahl an Liedern auswendig: japanische, deutsche und englische.“ (S. 17)
Die Kontraste zwischen deutschen und japanischen Lebenswelten treten klar hervor: das großbürgerliche deutsche Elternhaus mit opulentem Besteck, die einsame Mutter im Kimono am kleinen
Küchentisch.
Was ich an Kuhns Roman besonders schätze, ist die Feinfühligkeit, mit der sie kulturelle Unterschiede, familiäre Missverständnisse und die subtilen Verletzungen des Alltags beobachtet. Ohne in
Pathos zu verfallen oder zu überzeichnen, setzt Yuko Kuhn auf stille Intensität. Ihr Stil ist unaufgeregt, präzise und zugleich zutiefst empathisch, der sowohl Nähe zu den Figuren als auch
literarische Eleganz herstellt.
Für mich entsteht eine leise Intensität, die lange nachwirkt.
Onigiri ist mehr als eine Geschichte über Fremdsein und kulturelle Unterschiede. Es ist ein Buch über das Altwerden, über Erinnerungen, die wie Anker Halt geben, und über die zarte, aber starke
Bindung zwischen Mutter und Tochter. Die japanischen Reisbällchen, die dem Buch den Titel geben, sind Symbol für Trost, Verbundenheit und die Möglichkeit, sich trotz aller Unterschiede immer
wiederzufinden.
Fazit
Ich habe Onigiri als ein leises, sehr berührendes Debüt erlebt, das mich nachdenklich gemacht hat. Yoko Kuhn erzählt eine deutsch-japanische Familiengeschichte in all ihrer Komplexität. Für mich
ist es ein Buch, das lange nachhallt und das ich jedem ans Herz legen möchte, der Geschichten über Familie, Erinnerung und kulturelle Zugehörigkeit schätzt.
„Ich weiß, ich werde meine Mutter nie wieder nach Japan bringen können.“ (S. 174)
Yuko Kuhn
Onigiri
Hanser Berlin
erschienen 22.07.2025
Arbeit zitieren
Autorin Petra Gleibs, August 2025, Buchvorstellung Onigiri, Yuko Kuhn
https://www.lesenueberall.com/onigiri-yuko-kuhn/
Kommentar schreiben